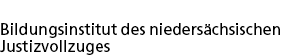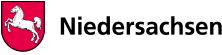Koordinatorin für Mediation im Justizvollzug:
Petra Timm
Bildungsinstitut des nds. Justizvollzuges
Philosophenweg 49
38300 Wolfenbüttel
Tel.: 0 53 31 / 98 47 223
E-Mail: Petra.Timm@justiz.niedersachsen.de
Anmeldungen und Informationen bei der Koordinatorin
Mediation
Ein wirksamer Weg, Konflikte konstruktiv zu lösen
„Verlierer geben keinen Frieden“
Palästinensisches Sprichwort
20 Jahre Mediation im niedersächsischen Justizvollzug
Im niedersächsischen Justizvollzug wird die Mediation als Möglichkeit der Konfliktbearbeitung seit 20 Jahren angeboten. Zeit für eine Rückschau!
Im Jahr 2005 wurde für den niedersächsischen Justizvollzug 20 Mediatorinnen und Mediatoren ausgebildet, die dem Nds. Justizvollzug zur Verfügung stehen. Während bis dahin Konflikte in den Justizvollzugseinrichtungen oftmals durch die Umsetzung von Personal gelöst wurden, bestand nun die Möglichkeit, sich aktiv Konflikten anzunehmen und unter Zuhilfenahme der Mediatorinnen und Mediatoren Verantwortung für die eigenen Konflikte zu übernehmen.
Die Koordination für Mediation ist organisatorisch dem Bildungsinstitut des nds. Justizvollzuges zugeordnet.
Bedienstete des Justizvollzuges können sich im Konfliktfall eigenständig an die Koordinationsstelle wenden. Die Vermittlung an die Mediatorinnen und Mediatoren erfolgt über das Bildungsinstitut. Daneben besteht die Möglichkeit für Auftraggeberinnen und Auftraggeber (z.B. Vorgesetzte) eine Mediation zu vermitteln.
In den vergangenen 20 Jahren hat sich Mediation zu einem festen Bestandteil zur Bearbeitung von Konflikten entwickelt. Jährlich werden ca. 10-15 Mediationen angeboten und durchgeführt.
Wirkungsmöglichkeiten im Justizvollzug
Konfliktbewältigung ist ein zentrales Thema im Justizvollzug. Konflikte treten zum einen zwischen Inhaftierten zum anderen aber auch in der Zusammenarbeit zwischen Bediensteten und mit Vorgesetzten auf. Unterschiedliche Funktionen und Erwartungen, eigene Sichtweisen und Zielsetzungen, Probleme mit der teaminternen Zusammenarbeit sowie mit übergeordneten Bereichen können im Berufsalltag Konflikte verursachen. Nicht selten spielen zwischenmenschliche Beziehungen oder die hierarchische Struktur im Justizvollzug eine nicht unerhebliche Rolle. Im Konfliktfall reden wir häufig nicht mehr miteinander, sondern übereinander oder brechen gar gänzlich den Kontakt ab. Die Zusammenarbeit ist dann belastet; das Arbeitsklima verschlechtert sich. Bedienstete leiden unter ungelösten Konflikten und ziehen sich nicht selten in die Krankheit zurück. Ungelöste Konflikt und ein zunehmend schlechtes Arbeitsklima wirkt sich nachteilig auf Arbeitsmotivation, Leistung, Arbeitszufriedenheit und die eigene Gesundheit aus.
Mediation im Justizvollzug kann daher als ein Angebot der Gesundheitsförderung verstanden werden. Sie eröffnet die Chance, Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhöhen und so die Qualität der Arbeit zu sichern bzw. zu steigern. Weniger ungelöste Konflikte sowie die Vermeidung der Eskalation von Konflikten führen zu einem gesunden und motivierenden Arbeitsklima. Mediation fördert eine zivilisierte Streitkultur.
Geschichte der Mediation?
Der Begriff "Mediation" stammt aus dem Lateinischen und wird von dem Adjektiv "medius" abgeleitet. Das Adjektiv "medius" bedeutet soviel wie "in der Mitte stehend" bzw. "keiner Partei zugewandt". Verfolgt man die Geschichte der Mediation, so wird man feststellen, dass die Wurzeln der Mediation bereits in der Antike, in den alten Stammesgesellschaften Afrikas sowie in asiatischen Kulturkreisen zu finden sind.
Traditionell haben außergerichtliche Konfliktlösungsmethoden in der asiatischen Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Während die westlichen Kulturen besonderen Wert auf das Recht eines Individuums legen, wird die Identität des Einzelnen im asiatischen Kulturkreis viel stärker durch die Beziehung im sozialen System definiert: " Einen Freund, Kollegen oder Geschäftspartner zu behalten" wird dort um ein vielfaches höher bewertet, als "einen Sieg zu erringen bzw. Recht zu bekommen".
In Europa sind erste mediative Konfliktlösungen im Mittelalter zu finden. Bereits 1648 wurde in den Verträgen des "Westfälischen Friedens" ausdrücklich der Mediator "Alvise Contarini" genannt, der über einen Zeitraum von fast 5 Jahren zwischen streitenden Parteien mit Erfolg vermittelt hat.
In Deutschland wurde Mediation Ende der 70er Jahre zunehmend bekannt. Zunächst beschränkte sich das Einsatzgebiet von Mediation auf Ehe- und Familienstreitigkeiten. Als Methode der Konfliktvermittlung nahm sie dann zunehmend Raum in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein. Neben dem Einsatz von Konfliktlotsen an Schulen wurde Mediation aber auch bei Konflikten in der Wirtschaft und insbesondere als Täter-Opfer-Ausgleichs im Rahmen von Strafverfahren eingesetzt.
Im Justizvollzug hat die Mediation in den letzten 20 Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Neben Supervision und Krisenintervention ist Mediation im Justizvollzug ein Angebot, Konflikte konstruktiv mit dem Ziel einer einvernehmlichen Einigung zu lösen.
Was ist Mediation?
Konflikte sind selten willkommen! Trotzdem gehören sie zum Alltag und entstehen gleichermaßen in der Familie, im Berufsalltag oder auch im Wirtschaftleben. Doch wer verfügt schon über eine wirkungsvolle Methode, Konflikte zufriedenstellend zu lösen? Der Organisationspsychologen F.Glasl geht davon aus, dass hinter jedem Konflikt die Dynamik einer Eskalation steht (vgl Glasl; Konfliktmanagement; Bern Stuttgart 1999), so dass Konflikte nicht selten in einem "Totalen Krieg" enden. Je früher eine Intervention in den Konflikt erfolgt, desto größer ist die Möglichkeit, den Konflikt konstruktiv und einvernehmlich zu lösen.
Das Kernstück der Mediation ist das "Harward-Konzept", eine integrative Verhandlungsmethode, die einen Ausgleich der Interessen anstrebt und Abstand von einem konkurrenzbetonten Verhandlungsstil nimmt (vgl. Fisher/Brown; Das Harvard Konzept; Frankfurt /M 2000). Verhandeln nach dem "Harward-Konzept" bedeutet:
- Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln
- Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen
- Optionen zum beiderseitigen Vorteil entwickeln
- Anwendung neutraler Beurteilungskriterien
Im Alltag sind wir es häufig gewohnt, Konflikte z.B von Vorgesetzten oder Gerichten etc. entscheiden zu lassen. Dabei entsteht meist die Situation, dass nur eine Konfliktpartei mit der Lösung einverstanden und zufrieden ist (Win-Lose-Strategie). Auf Kosten der gegnerischen Konfliktpartei versuchen wir so, unsere Interessen durchzusetzen. Mediation hingegen verfolgt immer eine "Win-Win Strategie". Dabei wird von der Grundannahme ausgegangen, dass beide Konfliktparteien "okay" sind und gleichermaßen ein berechtigtes Interesse haben. Voraussetzung für die Durchführung einer Mediation ist die freiwillige Teilnahme der Medianten.
Im Mediationsverfahren werden zunächst systematisch Streitgegenstände isoliert, um Optionen zu entwickeln, über Alternativen nachzudenken und eine konsensuale Übereinkunft zu treffen, die ihren Bedürfnissen gerecht wird. Insofern wird die Selbstverantwortung der Konfliktparteien für ihre Entscheidungen, die ihr Leben und ihre Arbeit betreffen besonders betont.
Die Rolle der Mediatorin / des Mediators ist dabei immer neutral und unparteilich. Er/Sie ist Gesprächsführer, der die Kommunikation initiiert oder eine effektivere Kommunikation ermöglicht. Die Mediatorin / der Mediator unterstützt streitige Parteien bei der Lösung eines Konfliktes um eine gemeinsam akzeptierte Lösung oder Vereinbarung zu treffen.